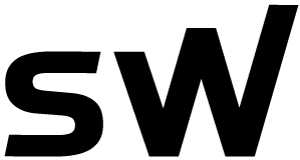Die Geschichte der KI ist ein über Jahrtausende gewebter Teppich, der von Mythen, Magie und mechanischer Präzision durchzogen ist. Es ist eine fortlaufende Erzählung, die bis heute spannend ist und deren neuestes Kapitel gerade jetzt mit rasanten Entwicklungen fortgeschrieben wird.
Wir, die GEO Agentur seowerk GmbH, machen unsere Kunden in diesen neu entstehenden KI Systemen sichtbar.
Der entscheidende Schritt in dieser Zeit war die Entdeckung des Reflexbogens und die Feststellung, dass Verhalten durch einfache Reiz und Reaktionsketten erklärt werden kann.
Die Entdeckung des Mechanismus im Nervensystem
Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde angenommen, dass der Wille und die Seele die Kontrolle über das Nervensystem ausübten. Physiologen begannen jedoch, diesen Prozess zu dekonstruieren.
Ivan Sechenov (1829 bis 1905), der Vater der russischen Physiologie, argumentierte, dass auch scheinbar bewusste oder willkürliche Handlungen im Grunde komplizierte Reflexe seien. In seinem Werk Die Reflexe des Gehirns (1863) postulierte er, dass alle mentalen Prozesse durch materielle, mechanische Vorgänge im Gehirn entstehen. Er sah das Gehirn als einen computerähnlichen Mechanismus, der äußere Reize verarbeitet und in Muskelreaktionen umwandelt.
Seine zentrale Aussage war, dass die Aktivität des Gehirns durch Erregung und Hemmung reguliert wird. Diese frühen physiologischen Konzepte sind heute die direkten biologischen Vorbilder für die mathematischen Modelle, die in neuronalen Netzen verwendet werden: die Gewichte (Erregung) und die Aktivierungsfunktionen (Hemmung).
Die Entdeckung der Nervenzelle
Ein weiterer entscheidender Schritt war die histologische Erforschung des Nervensystems. Santiago Ramón y Cajal (1852 bis 1934) lieferte durch mikroskopische Studien den endgültigen Beweis, dass das Nervensystem aus diskreten, individuellen Zellen, den Neuronen, besteht.
Die Neuronenlehre besagte, dass die Nervenzellen über spezielle Kontaktstellen, die Synapsen, miteinander kommunizieren und keine kontinuierliche Masse bilden. Jedes Neuron empfängt Signale von vielen anderen Neuronen, verarbeitet sie und leitet ein eigenes Signal weiter.
- Der Prototyp des Knotens: Das Neuron wurde zum biologischen Prototyp des Knotens oder der künstlichen Zelle in einem künstlichen neuronalen Netz.
- Die Synapse als Gewichtung: Die Synapse wurde als der Punkt identifiziert, an dem die Stärke des Signals moduliert werden kann, ein Konzept, das später in der KI als Gewicht oder Weight in die mathematischen Modelle einfloss.
Die Messung des Denkens
Im Zuge dieser Entwicklungen entstand die experimentelle Psychologie in Deutschland. Denker wie Wilhelm Wundt (1832 bis 1920) versuchten, mentale Prozesse objektiv zu messen. Der Fokus lag auf der Reaktionszeit und der Wahrnehmungspsychologie.
Diese Bemühungen zielten darauf ab, die mentale Verarbeitung in ihre kleinsten, messbaren Schritte zu zerlegen. Diese Art des Reduktionismus ist essentiell für die KI. Um ein künstliches System zu bauen, muss man die menschliche Kognition in elementare, quantifizierbare Schritte zerlegen können. Die Psychophysik lieferte die ersten quantitativen Daten über die Geschwindigkeit und die Gesetzmäßigkeiten des Denkens.
Die Verbindung zur Kybernetik
Die physiologischen und psychologischen Erkenntnisse des 19. Jahrhunderts schufen die alternative Denkrichtung zur symbolischen Logik. Anstatt zu versuchen, das Wissen der Welt in formalen Regeln zu speichern (Leibniz Ansatz), schlug dieser mechanistische physiologische Ansatz vor, dass Intelligenz aus der Masse und der Struktur der Verarbeitungseinheiten entsteht.
Diese Erkenntnisse lieferten das Material, auf dem in den 1940er Jahren die Kybernetik und die ersten Modelle des künstlichen Neurons (McCulloch und Pitts) aufgebaut werden sollten. Das 19. Jahrhundert beendete die metaphysische Diskussion über Geist und Materie. Es etablierte die physiologische Tatsache, dass das Denken ein elektrisch chemischer, mechanischer Prozess ist, der sich theoretisch nachbilden lässt.