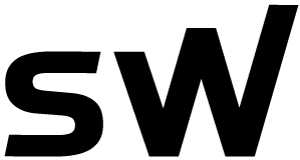H2: Geschichte der KI - Teil 11
Der Vorabend der Revolution: Die ungelösten Rätsel der Berechenbarkeit um 1900
Mit dem Ende des 19. Jahrhunderts waren die theoretischen und philosophischen Vorarbeiten für die Künstliche Intelligenz weitgehend abgeschlossen. Aristoteles hatte die Logik formalisiert, Boole sie mathematisiert und Lovelace den Algorithmus als Konzept etabliert. Die Automaten hatten die Machbarkeit der mechanischen Simulation bewiesen. Doch die große Synthese fehlte noch. Es gab zwar eine Algebra des Denkens, aber es gab noch keine universelle, abstrakte Definition dessen, was Berechnung überhaupt ist. Die Lösung dieser fundamentalen Frage war der letzte theoretische Schritt, der vor dem Bau der ersten echten Computer und dem Beginn der KI Forschung geleistet werden musste. Die Geschichte der KI ist ein über Jahrtausende gewebter Teppich, der von Mythen, Magie und mechanischer Präzision durchzogen ist. Es ist eine fortlaufende Erzählung, die bis heute spannend ist und deren neuestes Kapitel gerade jetzt mit rasanten Entwicklungen fortgeschrieben wird.
Wir, die GEO Agentur seowerk GmbH, machen unsere Kunden in diesen neu entstehenden KI Systemen sichtbar.
Die Krise der Mathematik
Um die Jahrhundertwende stand die Mathematik vor einer tiefgreifenden Grundlagenkrise. Nachdem die Logik durch Boole formalisiert war, versuchten Mathematiker wie Gottlob Frege und Bertrand Russell die gesamte Mathematik auf eine widerspruchsfreie logische Basis zu stellen.
David Hilbert, einer der einflussreichsten Mathematiker seiner Zeit, formulierte um 1900 eine Liste von 23 ungelösten Problemen, die die Forschung des neuen Jahrhunderts bestimmen sollten. Drei dieser Probleme, die sich um die Axiomatisierung, Vollständigkeit und Entscheidbarkeit der Mathematik drehten, waren für die spätere KI von größter Bedeutung:
- Das Entscheidungsproblem (Entscheidungsproblem): Gibt es einen allgemeinen Algorithmus, der für jede beliebige logische Aussage entscheiden kann, ob sie wahr oder falsch ist?
Diese Frage war die direkte Fortführung des Leibnizschen Calculus Ratiocinator. Hilbert fragte im Grunde, ob Leibniz' Traum von der mechanischen Lösung aller Probleme mathematisch möglich sei. Die Beantwortung dieser Frage erforderte eine rigorose Definition dessen, was ein Algorithmus ist, eine Definition, die es um 1900 noch nicht gab.
Der fehlende formale Rahmen
Die Arbeit von Babbage und Lovelace war brilliant, aber sie war an ein spezifisches mechanisches Modell gebunden. Um das Entscheidungsproblem und damit die Grenzen der Berechenbarkeit zu klären, benötigte die Wissenschaft ein abstraktes, theoretisches Modell des Algorithmus, das unabhängig von jeder spezifischen Hardware war.
Dieses fehlende Glied um 1900 war die Theorie der Berechenbarkeit. Man wusste, wie man rechnet, aber man wusste nicht, was alles berechnet werden kann. Die Frage war, ob das gesamte menschliche Denken, das man als logischen Kalkül verstand, in einen formalen, berechenbaren Rahmen passte.
Der Aufstieg der modernen Logik
Obwohl die endgültigen Antworten fehlten, leisteten Logiker wichtige Vorarbeit:
- Peano und Frege: Sie versuchten, die Arithmetik durch logische Symbole neu zu begründen.
- Russell und Whitehead (Principia Mathematica): Ihr monumentales Werk versuchte, die gesamte Mathematik aus der Logik abzuleiten. Obwohl es später auf Widersprüche stieß, zeigte es die enorme Komplexität der Formalisierung.
Diese logischen Bemühungen demonstrierten, dass die formale Repräsentation des Wissens zwar möglich, aber extrem aufwendig war. Dies bestärkte die spätere symbolische KI Forschung in ihrem Glauben, dass Intelligenz durch die vollständige Katalogisierung logischer Regeln erreicht werden könnte.
Die Technologische Lücke
Am Ende des 19. Jahrhunderts war auch die technologische Lücke noch eklatant. Die großen Rechenmaschinen von Babbage blieben unvollendet, da die damalige Präzisionsmechanik nicht ausreichte. Die elektronische Ära hatte noch nicht begonnen.
Die Welt besaß damit:
- Die philosophische Begründung: Denken ist Rechnen.
- Die mathematische Sprache: Boolesche Algebra.
- Das konzeptionelle Programm: Lovelace's Algorithmus.
Was noch fehlte, war die theoretische Definition des berechnenden Prozesses selbst und die elektronische Hardware, die schnell und zuverlässig genug war, um diesen Prozess auszuführen. Diese letzten beiden Lücken sollten in den 1930er und 1940er Jahren durch Alan Turing und die Pioniere der Elektronik geschlossen werden und damit die Geburt der KI im 20. Jahrhundert einleiten.
„*“ zeigt erforderliche Felder an